Die Zahlen zur Schweinehaltung zeigen diese Entwicklung sehr eindrücklich1:
- Aktuell gibt es etwa 15.250 schweinehaltende Betriebe, 520 weniger als im Vorjahr.
- Im Zehnjahresvergleich ist die Zahl der Betriebe um 10.600 und damit um 41 Prozent gesunken.
- Gleichzeitig ist der Schweinebestand um rund 25 Prozent zurückgegangen, was einem Minus von 7,2 Millionen Tieren entspricht.
- Während ein Betrieb im Jahr 2015 durchschnittlich knapp 1.100 Schweine hielt, waren es zehn Jahre später fast 1.400 Tiere pro Betrieb.
Eine aktuelle Umfrage der Interessengemeinschaft Schweinehalter Deutschlands (ISN) zeigt, dass der Rückgang der Schweinehaltung und die Konzentration auf größere Betriebe anhalten wird. So geben knapp 19 Prozent der Sauenhalter mit einem Bestand unter 200 Tieren an, in den nächsten fünf Jahren aussteigen zu wollen, während dies nur knapp über
4 Prozent in der Gruppe der Halter mit über 500 Sauen sagen. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Mastschweinen. 16 Prozent der Betriebe mit weniger als 900 Mastplätzen geben an, in den nächsten fünf Jahren aussteigen zu wollen, während dies in der Gruppe der Betriebe mit über 2.500 Mastplätzen nur drei Prozent sagen.2
Wir brauchen eine diverse Landwirtschaft
Diese Entwicklung treibt auch Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer um, der schon vor der Veröffentlichung dieser Ergebnisse sagte: „Der Rückgang der schweinehaltenden Betriebe […] bereitet mir Sorgen. Tierhaltern müssen wir die Chance geben, sich zu entwickeln.“
Die Sorge ist berechtigt, denn wir brauchen eine diverse Landwirtschaft. Kleinere Betriebe erfüllen in ihren Regionen vielfältige Aufgaben. Sie tragen nicht nur zur Wertschöpfung bei und schaffen Arbeitsplätze, sondern leisten auch einen Beitrag zur Biodiversität und der Pflege der Kulturlandschaft. Nicht zuletzt sichern sie die regionale Versorgung mit hochwertigen Lebensmitteln – und sind damit ein wichtiger Resilienzfaktor im Kontext der strategischen Ernährungssicherheit.
Wachsende Anforderungen setzen Tierhalter unter Druck
Was ist der Grund dafür, dass viele Betriebe die Nutztierhaltung aufgeben? Eine große Rolle spielen die vielen Herausforderungen, vor denen die Landwirtinnen und Landwirte stehen. Diese sind insbesondere für kleinere Betriebe schwer zu bewältigen.
Da sind zum Beispiel die steigenden Ansprüche der Verbraucherinnen und Verbraucher in Bezug auf Tierwohl. Laut einer Umfrage der europäischen Verbraucherschutzorganisation BEUC in acht EU-Mitgliedstaaten – darunter Deutschland – befürworten fast 90 Prozent der Befragten die Anhebung von Tierhaltungsstandards. Allerdings geben nur knapp 70 Prozent an, dafür auch mehr zahlen zu wollen.3 Ob diese 70 Prozent diesen Willen an der Supermarktkasse auch wirklich in die Tat umsetzen würden, bleibt fraglich. Gleichzeitig übt der Lebensmitteleinzelhandel Druck auf die Landwirte aus: Sie sollen Fleisch nach höchsten Tierwohlstandards liefern, die Produktionskosten jedoch gering halten. Währenddessen sehen sich Schweinehalter mit hohen Betriebskosten konfrontiert. So nannten in der Umfrage der ISN rund 38 Prozent der befragten Betriebe die Kostenentwicklung als wesentlichen externen Einflussfaktor bei Investitionsentscheidungen.
Hinzu kommen wachsende Anforderungen an Tierhalter in Bezug auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Einerseits ist klar, dass Landwirte einen Beitrag zur Reduktion der Emissionen leisten müssen und wollen. Ebenso klar ist jedoch, dass eine emissionsfreie Tierhaltung nicht möglich ist. Zudem werden Landwirte immer stärker aus der Wertschöpfungskette aufgefordert, Angaben zu Emissionen und vielem mehr zu machen. Dies stellt einen erheblichen Aufwand dar – insbesondere für kleinere Betriebe. Gleichzeitig zeigt der Bereich der Nachhaltigkeit sehr eindrücklich, dass den Landwirten Planungssicherheit fehlt. Bei Investitionszeiträumen von vielen Jahren muss Klarheit darüber herrschen, welcher gesellschaftliche und politische Weg hier mittel- und langfristig gemeinsam gegangen werden soll.
Eine weitere Herausforderung für tierhaltende Betriebe ist der Mangel an Arbeitskräften und eine häufig ungeklärte Nachfolgeregelung auf den Höfen. Hier spielen nicht nur die hohe Arbeitsbelastung, sondern auch die fehlende Wertschätzung für die Branche – und insbesondere für Tierhalter – eine Rolle.
Investitionen müssen sich lohnen
Vor diesem Hintergrund überrascht es wenig, dass sich nicht alle Tierhalter dazu in der Lage sehen, den mannigfachen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Manche steigen sogar aus, weil sie für sich und ihr Unternehmen in diesem Bereich keine Zukunft sehen.
Positiv stimmt mich, dass laut der Ergebnisse unseres aktuellen Rentenbank-Agrarbarometers die Stimmung in der landwirtschaftlichen Branche insgesamt eine positive Tendenz aufweist:
- 84 Prozent der befragten Landwirtinnen und Landwirte bewerten ihre aktuelle Situation als sehr gut, gut oder befriedigend.
- 59 Prozent erwarten, dass sich ihre Situation zukünftig noch verbessert oder gleich bleibt.
Die Verkaufspreise und die Kosten für Betriebsmittel wurden als zentrale Faktoren für die Bewertung genannt. Zudem wurden die Agrarpolitik, Bürokratie und Planungssicherheit erwähnt, jedoch ausschließlich als negative Einflussfaktoren. Auch in der Befragung der ISN werden diese drei Aspekte als entscheidend für Investitionsentscheidungen hervorgehoben.
Die laut Agrarbarometer grundsätzlich leicht verbesserte Stimmung schlägt sich auch in der Investitionsbereitschaft nieder:
- In den vergangenen 12 Monaten haben 77 Prozent der Landwirte investiert.
- In der Schweine- und Geflügelhaltung haben 84 Prozent investiert, gefolgt von den Milchvieh- und Rinderhaltern mit 80 Prozent.
- Die Investitionen konzentrierten sich hauptsächlich auf Maschinen und den Um- und Neubau von Ställen.
Die Zahlen deuten darauf hin, dass Landwirte eher bereit sind zu investieren, wenn die Verkaufspreise attraktiv sind und die Kosten moderat bleiben. Das ist nachvollziehbar, denn Landwirte sind Unternehmer und Investitionen müssen sich rentieren. Allerdings sind dies, wie eben bereits erwähnt, nicht die einzigen Faktoren, die eine Investitionsentscheidung beeinflussen, denn auch die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen spielen eine entscheidende Rolle.
Mit Blick auf die zukünftige Entwicklung dieser Faktoren bleibt die Branche entsprechend zögerlich, was Investitionen angeht:
- 65 Prozent der Landwirte (vorher 60 Prozent) planen weitere Investitionen.
- 16 Prozent der Tierhalter haben angegeben, in den nächsten zwei bis drei Jahren auf eine höhere Haltungsform umstellen zu wollen.
- Darunter planen 61 Prozent Um- und Anbauten, während 32 Prozent Stallneubauten in Betracht ziehen.
Es braucht die richtigen Rahmenbedingungen
Auch wenn Landwirte vor dem Hintergrund der vielen Herausforderungen und Investitionshürden skeptisch bleiben, ist erkennbar, dass sie auf eine positive Veränderung der Investitionsfaktoren mit einer steigenden Bereitschaft zu investieren reagieren. Das gilt es zu nutzen, indem die notwendigen Rahmenbedingungen geschaffen und Unterstützung zur Bewältigung der Herausforderungen bereitgestellt wird.
Eine verlässliche politische Regulierung, Planungssicherheit und der Abbau von Bürokratie sind entscheidend, damit Tierhalter langfristig investieren können. So ist es zum Beispiel wichtig, dass die Definition eines tierwohlgerechten Stalls nicht ständig verändert wird. Wenn ein Landwirt erhebliche Summen in den Bau eines solchen Stalls investiert, sollte er die Möglichkeit haben, diesen über einen Zeitraum von 20, 30 oder sogar mehr Jahren unter den festgelegten Bedingungen zu betreiben. Nur so kann sich die Investition langfristig lohnen.
Weitere Faktoren sind Investitionsanreize und die Stimmung in der Gesellschaft, die sich in der Wertschätzung – auch der monetären – gegenüber den Tierhaltern zeigen muss.
Beim Thema Investitionsanreize spielt die Rentenbank eine zentrale Rolle. Mit Förderprogrammen zum Neu- und Umbau von Ställen, wie z.B. dem Zukunftsfeld Stallumbau für mehr Tierwohl, bei dem wir Kredite zu Premium-Konditionen vergeben, fördern wir Investitionen in die Zukunft der Tierhaltung. Ein anderes Beispiel ist der Zuschuss Klimabilanz, mit dem wir die Beratungsleistung zur Erstellung einer Klimabilanz für den landwirtschaftlichen Betrieb fördern. Durch diese können wichtige Daten erhoben und Maßnahmen zur wirtschaftlich sinnvollen Reduktion von Emissionen erarbeitet werden.
Unsere Fördervolumina aus dem letzten Jahr und dem ersten Halbjahr 2025 zeigen, dass diese Unterstützung entscheidend ist, um den Tierhaltern die Möglichkeit zu geben, ihre Betriebe zu modernisieren und auf die Herausforderungen der heutigen Zeit zu reagieren.
Gesa und ihre Förderstory

Ein Beispiel für die erfolgreiche Unterstützung durch Investitionsanreize ist der Betrieb von Gesa Langenberg, einer Schweinehalterin, die von unseren Förderprogrammen profitiert hat.
Sie hat mit Förderung der Rentenbank in einen modernen Stall investiert, der nicht nur artgerechte Tierhaltung ermöglicht, sondern auch deutlich weniger Emissionen verursacht, zum Beispiel durch die Kot-Harn-Trennung, wodurch die Entstehung von Ammoniak zu einem großen Teil verhindert wird.
Die Geschichte von Gesa macht deutlich, wie entscheidend Investitionsanreize für die Zukunft der Tierhaltung sind. Dank der finanziellen Unterstützung konnte Gesa ihren Betrieb modernisieren und auf höhere Haltungsformen umstellen.
Hier geht's zur Förderstory von Gesa.
Fazit
Die Tierhaltung in Deutschland sieht sich mit großen Herausforderungen konfrontiert. Klar ist: Wenn wir Tierhaltung in Deutschland wollen, braucht Tierhaltung die passenden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Wir alle müssen unseren Teil beitragen - Politik, Handel, Verbraucher und wir als Rentenbank. Gemeinsam können wir sicherstellen, dass die Tierhaltung auch zukünftig nach hohen Standards erfolgt und einen wesentlichen Beitrag zur regionalen Wirtschaft und Versorgungssicherheit leistet. Die Erfolgsgeschichte von Gesa beweist, dass Investitionen in die Zukunft der Tierhaltung möglich und notwendig sind, um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen.
Weitere Förderstories finden Sie hier.
Weitere relevante Links:
https://www.schweine.net/news/isn-umfrage-2025-zeichnet-deutliches-lagebild.html
#Tierhaltung #Tierwohl #Schweinehaltung #Landwirtschaft #Nachhaltigkeit
1 https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/07/PD25_238_413.html
2 https://www.schweine.net/news/isn-umfrage-2025-das-sind-die-ergebnisse-im-detail.html
3 https://www.vzbv.de/pressemitteilungen/umfrage-verbraucherinnen-wuenschen-sich-hoehere-tierhaltungsstandards
Zurück zur Übersicht
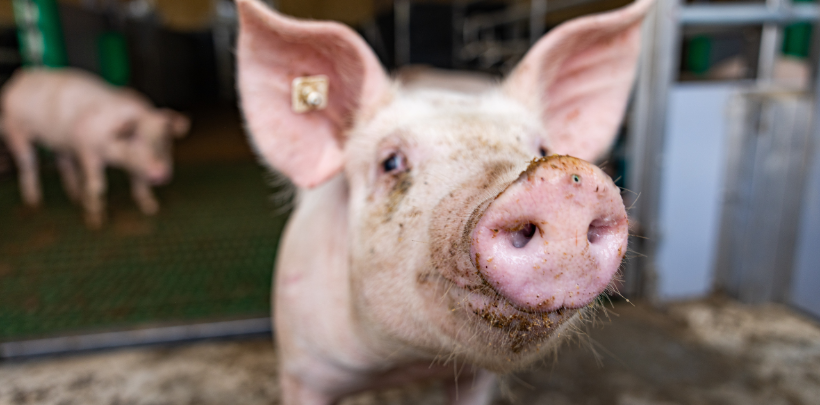
Kommentare